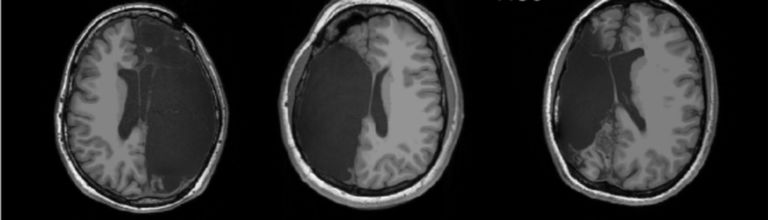aus F.A.S.
- LEBEN
Mama, machen wir jetzt mein Referat?
Mehr
als zehn Jahre lang hat Anke Willers die Hilfslehrerin für ihre beiden Töchter
gespielt. Sie wusste, es ist pädagogisch falsch – aber die Schulen erwarten es
stillschweigend, und alle Eltern tun es. Jetzt hat sie ein Buch darüber
geschrieben. Ein Vorabdruck.
Vielleicht ist es das bayerische Schulsystem,
vielleicht hatten meine Kinder auch besonders ambitionierte Erstklasslehrer,
vielleicht hatten die Mütter im Kindergarten doch recht gehabt mit ihrer
vorschulischen Leseförderung – auf jeden Fall war die Botschaft bei beiden
Kindern: „Bis Weihnachten müssen die einigermaßen lesen können. Und deshalb
müssen Sie üben, üben, üben. Jeden Tag mindestens 15 Minuten, besser mehr“,
hieß es am ersten Elternabend. Mit „Sie“ war ich gemeint. Oder der Kindsvater. Oder die Omas und Opas. Da unsere Großeltern Hunderte von Kilometern entfernt lebten und der Kindsvater am anderen Ende der Stadt Vollzeit arbeitete, blieb nur ich übrig. Denn ich hatte meine Stunden in der Redaktion wegen der Kinder reduziert.
Letzteres war auch nötig, denn bis Weihnachten war nicht viel Zeit. Ich versuchte damals auch, mich daran zu erinnern, wann ich selbst lesen gelernt hatte. Ich glaube, ich konnte es erst irgendwann um Pfingsten – was aus bayerischer Sicht kein Wunder ist, denn in Bayern gelten Menschen, die in nördlichen Bundesländern zur Schule gegangen sind, gerne mal als arme Würstchen mit Spar-Abitur.
Als meine Töchter in die Grundschule gingen, gab es für Leseanfänger Arbeitsblätter und -bücher mit „Mimi, die Lesemaus“. Bis heute habe ich eine gewisse Hochachtung vor den Leuten, die sich die Erstklassmaterialien ausdenken. Ich meine, das muss man erst mal hinkriegen: Lesesätze kreieren, wenn man dafür nur das A, das I und eine Handvoll weiterer Laute zur Verfügung hat. Die Macher der Erstklasslesebücher schienen da allerdings völlig schmerzbefreit und dichteten Sätze von schlichter Schönheit: „Mimi malt lila Marias.“ „Backmeister Bimbam backt braune Brezn.“ „Oma ist am Lamm.“ „Ali ist am Ast.“
Mal abgesehen davon, dass es mir oft schwerfiel, bei dieser Lektüre konzentriert zu bleiben und nicht nebenher die Spülmaschine auszuräumen oder wenigstens die Post durchzusehen, war ich immer froh, wenn die Kinder keine weiteren Fragen stellten. Ich wäre relativ ratlos gewesen, wenn sie gefragt hätten, was es bedeutet, dass Ali am Ast ist. Hat der Mann Selbstmordabsichten? Handelt es sich um einen Waldarbeiter mit Migrationshintergrund? Und warum ist Oma am Lamm? Zum Streicheln. Zum Kochen. Oder muss sie ihre Rente aufbessern und arbeitet stundenweise in der Frischfleischabteilung?
Fakt war: Wir übten. Und ich versuchte dabei möglichst wenig vorzusagen. Doch anscheinend war das nicht genug. Im Mitteilungsheft stand regelmäßig: „Greta liest die neuen Wörter zu stockend und zu ungenau und muss mehr üben.“
Und in den Schreibheften, die ich wegen der lustigen Verballhornungen jahrelang aufgehoben habe, gab es neben dem „Furzelgemüse“ Kommentare in roter Korrekturschrift: „Wurzelgemüse! Greta, übe den Unterschied zwischen dem weichen W und dem scharfen F.“ Oder: „Bitte die Merkwörter noch mal ordentlich abschreiben.“ Oder: „Greta, gib Acht beim G: Das Schwänzchen muss nach unten in den Keller.“
Wie ich versuchte, mich zu kümmern – aber nicht zu viel
Eltern sollten keinen Druck machen.
Eltern sollten keinen Druck machen.
Eltern sollten keinen Druck machen.
Diesen Satz habe ich so oft gehört, dass ich ihn hier gleich mehrmals hinschreiben muss. Manchmal stand er sogar in der Zeitung. Meistens dann, wenn es Zeugnisse gab und meine Journalisten-Kollegen von den Tageszeitungen Psychologen zum Thema schlechte Noten befragten. Deren Credo lautete: „Bitte ganz entspannt bleiben. Immer dran denken: Kein Kind will schlechte Noten haben. Und: Bitte! Keinen! Druck! Machen!“
Natürlich sollen Eltern keinen Druck machen auf Kinder, die sieben Jahre alt sind oder acht. Auch nicht auf Kinder, die zwölf sind oder 13. Druck macht eine Matschbirne. Druck ist schlecht, wenn man herausfinden soll, wie lange die Nacktschnecke Gertrud kriechen muss, wenn sie zehn Zentimeter in der Minute schafft und die Straße, über die sie will, drei Meter breit ist.
Mir war das klar. Ich spürte aber auch sehr deutlich: Wir Eltern sollen uns um die Schulbelange unserer Kinder kümmern, wir sollen uns einbringen. Die Schule braucht uns, weil sie personell und auch sonst so knapp bestückt ist, dass der Laden ohne elterliche Unterstützung nicht läuft.
Kann man als berufstätige Mutter in diesem ganzen Durcheinander von widersprüchlichen Botschaften einigermaßen entspannt bleiben?
Ja, man kann. Und auch, wenn es viel Kraft kostet: Solange die Kinder gut in der Schule sind und wenn alles läuft, wie es soll, kriegt man es irgendwie hin. Ohne Burnout. Ohne Helikopter. Und ohne dass das schlechte Gewissen übermächtig wird. Aber wenn es nicht so läuft, ist es fast unmöglich.
Wenn es nicht so läuft in der Schule, fällt einem die Mutterrolle nämlich auf die Füße. Oder das, was die Gesellschaft unter einer guten Mutter versteht. Dann heißt es: „Du musst dich mehr kümmern. Aber bitte ganz entspannt und auch nicht zu viel. Denn wenn du dich zu viel und unentspannt kümmerst, bist du eine Helikoptermutter, eine Tiger Mom, eine hysterische Eislaufmutter.“ Alles irgendwie unsympathisch – und alles auch wieder falsch.
Es ist verdammt schwer, sich genau richtig zu kümmern, wenn es nicht läuft in der Schule. Dann bedeutet Kümmern nämlich auch: Hausaufgaben nach dem Hort anschauen. Feststellen, dass sechs von zehn Matheaufgaben falsch sind und dass das Kind das Prinzip nicht richtig verstanden hat. Abends um fünf das Kind dazu bringen, sich die Sache noch mal anzuschauen. Und dann aushalten, wenn es vor Wut gegen die Schultasche tritt und „Scheiß Schule“ brüllt.
Oder bei der Drittklässlerin freitags nachfragen: „Sag mal, schreibt ihr nicht bald wieder Deutsch?“
„Mmh ...“
„Wann denn?“
„Nächsten Montag.“
„Oh, da musst du ja dann noch üben!“
„Samstag wollte ich aber schwimmen gehen, es soll 30 Grad werden ... Und am Sonntag ist Geburtstag bei Lisa.“
„Aber du hattest in der letzten Deutscharbeit eine Vier minus ...“
„Mama, ich will aber mit!“
Wenn es nicht läuft, steht im Zwischenzeugnis der dritten Klasse unter „ergänzende Bemerkungen“:
„Ida wendet die erlernte Abschreibtechnik noch nicht konsequent an. Auch zu Hause sollte sie vorher an die Abfolge der einzelnen Schritte erinnert werden. Ein Mitsprechen der jeweils zutreffenden Regel beim Schreiben würde ihre Rechtschreibsicherheit erhöhen. Im Bereich Schreiben sind der zusätzliche Übungsaufwand und die vermehrte Aufmerksamkeit beim Abschreiben von Texten sicherlich lohnend. Förderbedarf besteht auch bei den Einmaleinsreihen, welche noch intensiver eingeübt werden müssen. Mithilfe der Hefteinträge sollten auch zu Hause die Eigenschaften von Körpern wiederholt werden.“
Wie das Russische Reich
zerfiel und ich nicht dabei war
Kurz nach meinem Umzug in den Norden wurde Greta in ihrer Schule ein großes Referat angekündigt. Es trug den Titel: „Die Neuordnung Osteuropas nach 1918/1919“. Und es gehörte zur traditionellen Projektpräsentation, die viele der hiesigen Realschulen in der Neunten auf dem Lehrplan stehen haben. Sie umfasste ein 45-minütiges Gruppenreferat – mit Powerpoint-Präsentation und Plakat – sowie eine 20-seitige schriftliche Ausarbeitung mit Auswertung von Sekundärliteratur und Handout. Das Ganze sollte in Deutsch wie eine Schulaufgabe zählen und in Geschichte und IT wie eine Stegreifaufgabe.
Schon Wochen und Monate vor Beginn dieses Projekts waren alle aufgeregt. Denn keiner wusste so genau: Wie macht man so ein Referat mit 20 Seiten? Wie arbeitet man mit Sekundärliteratur? Wie macht man eine gute Präsentation? Die Schule bot zwar Hilfestellung an, aber selbst Eltern, die sonst nie den Personal Trainer gaben, war klar: Bei so einem großen Projekt müssen wir jetzt auch mit ran. Ohne uns geht das nicht. Schließlich sind Referate die Paradedisziplin für engagierte Hilfslehrer. Fast alle Eltern helfen. Und es soll sogar welche geben, die schreiben später an der Uni noch bei den Seminararbeiten mit.
Ja, natürlich ist das pädagogisch falsch. Es ist auch das Gegenteil von Chancengleichheit für die Kinder. Und ein weiteres schönes Beispiel dafür, warum Schulerfolg vom Elternhaus abhängt: Wer zu Hause Eltern hat, die einen ordentlichen Computer haben, einen Farbdrucker, Kenntnisse im Erstellen und Strukturieren von Präsentationen und vor allem Zeit, sich damit zu befassen, ist klar im Vorteil. Wer das nicht hat – Pech gehabt!
Denn auch wenn die meisten Lehrer es nicht laut sagen würden: Viele scheinen schlicht davon auszugehen, dass zu Hause jemand ist, der sich schon um die Referat-Genese kümmern wird. Oder wie sonst kann man es interpretieren, wenn schon Drittklässler aufgefordert werden, ein kleines Referat zum Killerwal zu machen: „Wir sollen ein paar Infos aus dem Netz holen, Mama. Aber ich darf ja gar nicht alleine an den Computer. Kannst du mit mir mal in das Erwachsenen-Internet gehen und gucken, wie der Killerwal seine Babys kriegt? Und dann sollen wir ein paar Fotos ausdrucken. Und Mama, wie macht man dann dazu fünf Minuten Referat?“
„Man überlegt sich, was wichtig ist. Und macht dazu Stichworte auf ein Blatt. Oder noch besser auf Karteikarten. Und dann erzählt man das vor den anderen.“
„Aber die Lehrerin hat gesagt, wir sollen dazu ein Plakat machen.“
In der Sechsten kommt dann das Englischreferat über ein Thema der Wahl.
„Mama, ich nehm’ James Bond“, sagt das Kind. „Ich mag den Daniel Craig. He’s a very good-looking guy.“
„Also gut“, sagt die mütterliche Hilfslehrkraft, „dann recherchier mal. Und dann machen wir ein rehearsal.“
„Re ... was? Aber Mama, was kann ich denn noch schreiben außer das mit dem good-looking?“, fragt das Kind, und schon fängt die mütterliche Hilfskraft an zu googeln: Aston Martin, Ursula Andress, Sean Connery, Skyfall, Casino Royale.
Jetzt also die Neuordnung Osteuropas nach 1918/19 auf 20 Seiten. Und ich war nicht da.
Greta schimpfte noch ein bisschen. Dann ging sie in die Stadtbücherei und holte Bücher. Versuchte Sekundärliteratur zu verstehen und Übersetzungen von Quellen. Fragte Google, Wikipedia und die üblichen Verdächtigen im Netz. Und wurschtelte sich durch die verschiedenen Frontverläufe und Abspaltungsbestrebungen der osteuropäischen Länder zwischen 1914 und 1918, während ich in meiner Hamburger Redaktion Texte aus dem 21. Jahrhundert bearbeitete.
Am Abend saß das Kind in München mit dem historisch interessierten Vater auf dem Sofa und redete über Lenin, den Zaren und die Unabhängigkeit Weißrusslands. Am Ende hatte es den Blocksatz vergessen, die Sekundärliteratur nicht ganz richtig zitiert und wusste in der Ausfragestunde nicht genau, was Kapitalismus ist. Das gab ein paar Punkte Abzug bei Pflicht und Kür. Ich gab ihr eine Eins mit Sternchen für selbständiges Arbeiten. Und mir ebenfalls: fürs Raushalten.
Die hier abgedruckten Auszüge sind Anke Willers’ Buch
„Geht’s dir gut oder hast du Kinder in der Schule?“
entnommen, das am 8. Juli erscheint; Heyne Verlag, 19,99 Euro, 272 Seiten.